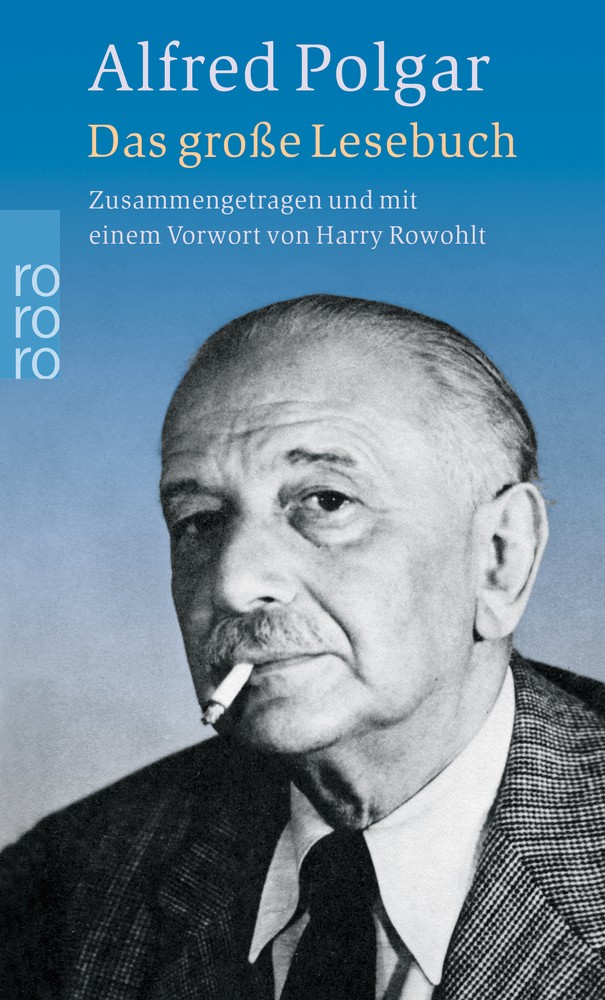Eine Buchbetrachtung zu:
Alfred Polgar, Das große Lesebuch
rowohlt, ISBN: 978-3-499-23806-2
Hunderteinunddreißig Kurzgeschichten und Aphorismen, geschrieben von 1907 (da war Alfred Polgar im vierunddreißigsten Lebensjahr) bis 1953 (zwei Jahre vor seinem Tod). Im Anschluss eine Zeittafel (aufschlussreich und hilfreich).
Das Leben ist zu kurz für lange Literatur, zu flüchtig für verweilendes Schildern und Betrachten, zu psychopathisch für Psychologie, zu romanhaft für Romane, zu rasch verfallen der Gärung und Zersetzung, als daß es sich in langen und breiten Büchern lang und breit bewahren ließe. (S. 177)
Alfred Polgar gehörte zu den Menschen, die zwei Weltkriege ertragen mussten, einschließlich Vorkriegszeiten und Nachkriegszeiten mit ihren Wirren, wobei die erste Nachkriegszeit und die zweite Vorkriegszeit kaum voneinander zu trennen sind. Bei seiner Geburt war das Deutsche Reich gerade zwei Jahre alt; er hat den Austrofaschismus und den deutschen Faschismus erlebt. Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand 1933 hat Polgar – bereits im sechzigsten Lebensjahr – mit seiner Frau Berlin verlassen und ist über Prag, Zürich, Paris, Lissabon in die Vereinigten Staaten von Amerika ins Exil gegangen; das Paar hat dort 1943 die Staatsbürgerschaft erhalten. Vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Rückkehr nach Europa, ohne eine eigene Wohnung zu nehmen. Der Menschenkenner, der zum misstrauischen Weltbürger geworden war, schien die Flüchtigkeit von Hotels vorzuziehen.
Alfred Polgar war ein unbestechlicher Beobachter des Lebens, der menschliche Regungen genau erkannt und treffsicher beschrieben hat. Das gilt für kleine Bilder aus dem Alltag wie für große Bilder aus der Politik. Man lese nur die Geschichte Der Hase (S. 113 ff.) über ein Haustier, das keines sein sollte. Oder Abschied vom Freunde (S. 307 ff.), eine literarische Antwort auf umnebelte Junggesellenabschiede. Oder Der Debütant (S. 313 ff.), eine Groteske, denn „Debütant“ und „Wien“ führen umgehend zum Bild vom ewigen Debütantinnen-Ball. Tatsächlich aber zeichnet diese Kurzgeschichte ein ganz anderes Szenario als die gesellschaftliche Einführung herausgeputzter Bürgertöchter. Oder Illusionen (S. 339 ff.) über das Weltgewissen der Spatzenhirne. Oder über den Herrenreiter (S. 347 ff.):
Das Risiko, seine nächsten Freunde und Mitarbeiter preisgeben zu müssen, hat Herr von Papen immer mit Entschlossenheit auf sich genommen.
Sein Bild von Ribbentropp, dass unwillkürlich an aktuelle Geisterfahrer in deutschen Talkshows und anderen Leitmedien erinnert, lautet (S. 350):
Kleinbürger von mäßiger, ungepflegter Intelligenz.
Oder Der Mantel (S. 354 ff.), mit gut fünfzehn Seiten eines der längeren Stücke, über Vertreter der Herrenrasse und die Gewöhnung an die Finsternis. Es gibt aber auch Aphorismen wie in En Passant (S. 341):
Deutsches Lustspiel. Der Humor trägt eine Tarnkappe; immerzu schreit er: „Ich bin da!“, und nie sieht man ihn.
Kommentar zur Dichtung? Geister werden nicht besser sichtbar, wenn man Licht macht.
Die Texte von Polgar sind auch Spuren der Kriege. Das Verheizen von Kanonenfutter (Perspektiven, S. 47), der Überdruss an Schießbuden im Prater (Wien, S. 48), die Instrumentalisierung von Russophobie in der Kriegspropaganda (Bilder, S. 51 ff.), Gespräche über Kriegserlebnisse (Nummer 28, S. 53), die vier Spielarten von Kriegsdichtern (Lyrische Betrachter, S. 55), Nöte einer Rückkehr (S. 57), die Verantwortung von Staatsmännern und Generälen (S. 81), sind klare Benennungen der Fähigkeit von Menschen zum Unmenschlichen. Alfred Polgar war kein Freund des Pathos und noch weniger von Feigheit.
Die letzen beiden Texte, entstanden 1951 bis 1953, kreisen bereits um den eigenen Tod.
▮